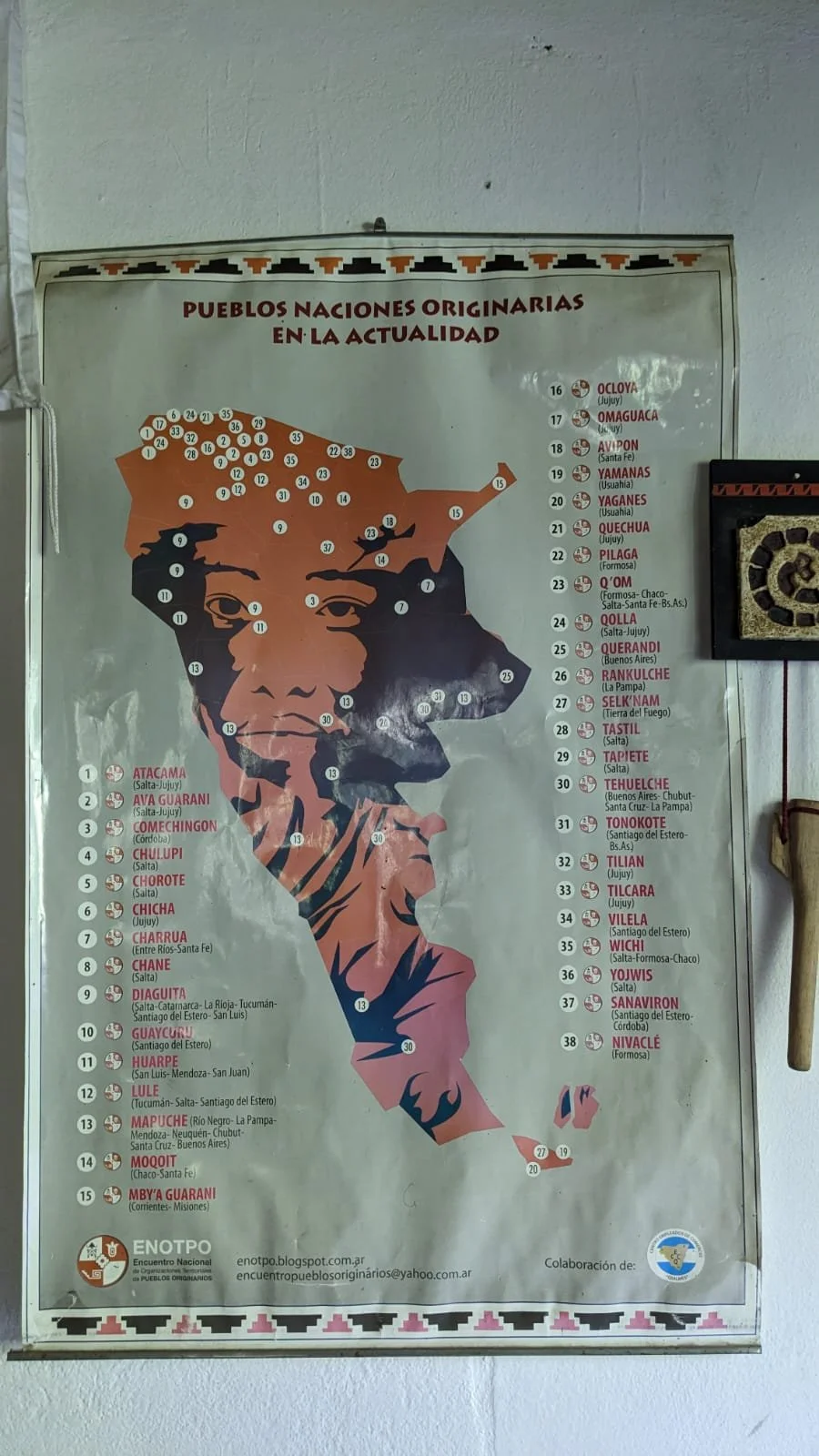Teil X - Geschichten, die ich nicht schreiben werde und die ich nicht geschrieben habe
Jürgen Langerfeld
Nun sitze ich hier in Copacabana und schaue auf den sonnenbeschienen Titicacasee. Copacabana ist nämlich nicht nur der sagenumwobene Strand in Rio, Brasilien, sondern auch ein Städtchen in Bolivien - bekannt für eine dunkelhäutige Marienstatue und die zeremonielle Segnung von Autos – wahlweise durch einen Priester oder Schamanen. Ich sitze hier, trinke etwas und schaue auf die Promenade runter, wo alle zwei Minuten ein Backpacker vorbei läuft. Ich glaube zu wissen, was sie treibt: Fernweh. Aber mein Fernweh hat sich im vergangenen halben Jahr in einem schleichenden Prozess in Heimweh verwandelt. Und das ist OK. Morgen gehen meine Flieger in Richtung Deutschland. Ich kehre auf der gleichen Route heim, wie ich ursprünglich 2020 herfliegen wollte, bevor mir damals Corona einen gehörigen Strich durch die Rechnung machte.
Und so soll das hier auch die letzte Geschichte meines Blogs werden. Problem ist nur, ich habe keine mehr bzw. Ich hab noch zu viele… Eigentlich wollte ich noch nach Peru und auch über Peru schreiben. Doch das wird nichts. Außerdem habe ich in den letzten Monaten einiges an Material gesammelt, das ich nicht ausformuliert habe. Und so schreibe ich nun die Geschichten, die ich nicht schreiben werde und die, die ich nicht geschrieben habe:
Da war Paula, eine Cousine von meinem Freund Jeremías. Ich habe sie auf einer Familienfeier in Rosario, Argentinien, kennengelernt. Wir kamen ins Gespräch und sie erzählte mir, dass ihre Mutter seit ihrem Outing nicht mehr mit ihr spricht. Paula glaubt, dass hier v.a. der katholische Glaube ihrer Mutter Einfluss entwickelt. Die katholische Kirche hat in Argentinien (immer noch) immensen gesellschaftlichen Einfluss… Paula lebt also bekennend homosexuell, was für sie mit einigen Hürden und nicht zuletzt gesellschaftlicher Diskriminierung verbunden ist. Sie setzt sich in einer lokalen Initiative für die Rechte der queeren Community ein. Sehr gerne hätte ich mich länger mit ihr ausgetauscht, als das auf der Familienfeier möglich war. Wir hatten uns schon verabredet, doch der Termin platzte, weil ihre Oma leider starb. Wie das Leben manchmal spielt…
Dann war da noch mein Aufenthalt in Bariloche, Argentinien, bei welchem ich mich ein wenig auf die Spuren von Nationalsozialisten begab, die nach dem Zweiten Weltkrieg unter Mithilfe des Vatikans und der Regierung Perón nach Argentinien kamen. Nicht selten ließen sie sich dort nieder, wo vor ihnen schon andere Deutsche eine neue Heimat fanden. Und das sind interessanterweise oft bergige Gegenden, die an den Süden Deutschlands erinnern: Der Norden Patagonien, oder die Sierra von Cordoba bspw.. Jedenfalls gelang es einigen Nationalsozialisten, sich in Argentinien eine neue Existenz aufzubauen – teils mit neuer Identität, teils aber auch mit ursprünglichem Namen. Erich Priebke, ehemals SS-Hauptsturmführer, bspw. lebte als hoch anerkanntes und einflussreiches Mitglied der deutschen Community in Bariloche. Im Umfeld der deutschen Schule ereignete sich dann aber ein Skandal: Er wurde von einem Reporter mit seiner Vergangenheit in der SS und Mitwirkung an einem Massaker in Italien konfrontiert. Es folgte eine Auseinandersetzung um seine Auslieferung, die nicht allein juristisch ausgefochten wurde. Bis heute befasst sich die deutschstämmige Gemeinschaft Bariloches mit der Aufarbeitung der Verbindungen zum Dritten Reich. Gerne hätte ich Einblicke gewährt in die Gespräche, die ich geführt habe, aber die darauffolgenden Wochen war ich ständig wandern im wunderbaren Patagonien. Und so war mir danach Vieles nicht mehr ausreichend präsent.
In Iguazu, Argentinien, war ich am gleichen Tag, an dem ich im Casa de Botellas war - aufmerksame Leser:innen erinnern sich - in einer Auffangstation für Wildtiere. Diese wurde seinerzeit von Juan Carlos Chébez gegründet, dem einflussreichsten Naturschützer Argentiniens, dessen Leben und Wirken ganz sicher mindestens eine Stelle in meinem Blog verdient hätte. Guirá Oga heißt die Station, was in der Sprache der Guaraní so viel bedeutet wie “das Haus der Vögel". Neben Vögeln wie Kakadus, oder Aras, werden aber auch Ozelots, Nasenbären, Brüllaffen u.v.m. geholfen. Die Naturschützer retten Wildtiere, bereiten sie auf ihre Wieder-Auswilderung vor und wildern sie schlussendlich aus. Die meisten Wildtiere wurden von Autos angefahren oder von kriminellen Tierschmuggel-Banden konfisziert. Zunächst werden die Tierchen in der Station in Iguazu wieder aufgepäppelt, bevor sie auf einer nahegelegenen Insel wieder an das Wildleben gewöhnt werden. Gelingt die Gewöhnung, werden sie in die freie Wildbahn entlassen. Ich sprach mit einer angehenden Tierärztin, die sich für das Wohl der Tiere ehrenamtlich einsetzt. Scheinbar ist die Auffangstation das Wunschziel schlechthin für die Praktika der angehenden Tierärzte Argentiniens. Außerdem arbeitet das Zentrum mit einer Vielzahl von Freiwilligen.
In Sucre, Bolivien, besuchte ich eine Stiftung, die sich für den Erhalt der indigenen Kulturtechnik der Stoffherstellung einsetzt. Wir sprechen hier über die farbenfrohen, komplexen Muster der Stoffe, für die Peru und Bolivien so bekannt sind. Sie werden einem vorort überall angeboten. Die Muster sind dabei so komplex, weil sie ähnlich ausdrucksstark sind wie eine Sprache. Wer die Farben und Muster zu deuten weiß, erkennt die darin festgehaltenen Geschichten. Nicht wenige Wissenschaftler argumentieren, es handele sich um eine Schrift. Ursprünglich brauchte eine Frau um einen Meter Stoff herzustellen bis zu 1,5 Jahre. Heute wird in Andendörfern zwar immer noch von Hand aber deutlich weniger aufwendig produziert. Es geht häufig nicht mehr um Kulturtransfer, sondern darum, die Lust der Touristen auf die Stoffe zu stillen. Dabei bleibt das meiste Geld bei Zwischenhändlern hängen. Die Stiftung ASUR (antopologos surandinos - Anthropologen der Südanden) möchte den Stoffen ihren ursprünglichen Wert zurückgeben und fördert den Erhalt der Kulturtechnik sowie die Forschung zum Thema.
Und last but not least hätte ich gerne aus Peru über die aktuellen Auseinandersetzungen und Konflikte dort geschrieben. Gleichzeitig sind es aber auch jene Konflikte, die mich davon abhielten, nach Peru zu reisen. Ich habe lange mit meinem Freund Karlo gesprochen, der in Peru geboren wurde und heute in Spanien lebt. Er erklärte mir ausführlich die Irrungen und Wirrungen rund um die Absetzung des Präsidenten Pedro Castillo, die zu den aktuellen Protesten führten. So ist es im besonderen die indigene Landbevölkerung, die derzeit protestiert, denn fur diese wollte sich Sanchez einsetzen. Eine tiefsitzende gesellschaftliche Konfliktlinie, die in Peru hier zum Tragen kommt und eigentlich Aufmerksamkeit verdient.
Und noch vieles mehr gäbe es nieder zu schreiben. Vielleicht mache ich das auch noch eines Tages. Dieser fantastische Kontinent, seine Vielfalt an Natur, Kultur und v.a. Seine Menschen haben mich berührt. Und was ich gesehen habe, war anders und doch überraschend ähnlich. Ähnlich sind die Probleme, anders ihre Intensität. Wir in Deutschland, in Europa sind der Problemlösung vielleicht ein klein wenig näher. Und ich denke zunehmend, dass der globale Süden jetzt und in Zukunft unsere Solidarität verdient – aus einer Vielzahl an Gründen. Das bedeutet ganz konkret, die Gesellschaften des globalen Südens an unserem Wohlstand teilhaben zu lassen.
Mir hat es große Freude bereitet, meine Reise mit Engagement-Geschichten anzureichern. Und so bleibt mir zum Schluss wenig mehr, als denen zu danken, die meine Artikel mit Interesse gelesen haben und denen meinen Dank auszusprechen, die all das ermöglicht haben.
Buen Camino und Vamos Arriba
Pipo